Der Laderegler
Die Stromversorgung bei einem Motorrad erfolgt durch einen Wechselstromgenerator (einphasig oder dreiphasig) in Verbindung mit einer Batterie und dazwischen geschaltetem Gleichrichter und Regler.
Der Generator liefert bei laufendem Motor eine Wechselspannung, deren Höhe in Abhängigkeit zur Drehzahl steht. Somit haben wir zwei Problem für die Spannungsversorgung zu lösen:
1. Gleichrichtung der Wechselspannung
Die Gleichrichtung erfolgt durch zwei Dioden je Phase. Bei der Auslegung der Dioden muß berücksichtigen werden, daß der maximal mögliche Strom und die im Generator entstehenden Spannungsspitzen nicht zur Zerstörung der Bauteile führen.
2. Regelung der Gleichspannung auf einen stabilen Wert, der die Verbraucher mit Spannung versorgt und gleichzeitig die Batterie lädt
Der Regler muß die gleichgerichtete Spannung auf einem möglichst stabilen Wert halten. Die ideale Spannung liegt zwischen 14 und 15V. Bei dieser Spannung wird die Batterie maximal geladen und die Verbraucher werden innerhalb ihrer Nennspannung betrieben. Eine zu niedrige Spannung würde die Batterie nicht oder nur unzureichend laden und die Verbraucher nur mit verringerter Leistung bzw. bei elektronischen Bauteilen gar nicht mehr funktionieren. Eine zu hohe Spannung führt zu einer “kochenden” Batterie und führt je nach Höhe der spannung entweder zu schnellem Ausfall der angeschlossenen Verbraucher oder zum Abschalten durch eingebaute Schutzeinrichtungen gegen Überspannung.
Der mechanische Regler
Bei dem mechanische Regler werden je nach Eingangsspannung Relais geschaltet, die ienen Teil der Spannung gegen Masse kurzschließen.
Die Hersteller haben Regler in allerlei Ausführungen konstruiert. Während beim einfacheren F-Regler ein Spulenelement reichte, sind bei anderen Typen oft zwei oder drei zu finden.
Er hat drei Regelelemente und ist in seinem Aufbau besonders übersichtlich. Nebeneinander liegen die Spulen für Spannungsregelung, Strombegrenzung und für den Rückstromschalter. Der U-Regler war in den Sechzigern in Sechs-Volt-Ausführung für Ladeleistungen von 90 bis 160 Watt und in Zwölf-Volt-Ausführung für Leistungen zwischen 90 und 300 Watt lieferbar. Hier haben Spannungs- und Stromregler jeweils einen eigenen Regelwiderstand, außerdem findet sich ein spezieller Abgleichwiderstand zwischen der Spannungs- und der Rückstromschalter-Spule.


Abb.1 mechanischer F-Regler Abb.2 mechanischer U-Regler
Beim mechanischen Regler erfolgt keine kontinuierliche Regelung sondern eine in Stufen geschaltete Lasterhöhung. Die eigentliche Regelung erfolgt in Schritten und kann somit nicht immer im optimalen Spannungsbereich liegen. Durch die immer noch vorhandenen Spannungsschwankungen arbeiten die Verbraucher häufig mit Überspannung, was zu vorzeitigem Ausfall führt. Die mechanischen Regler unterliegen außerdem einem Verschleiß. Zwar lassen sich die Schaltpunkte der Relais häufig einstellen. Doch dies ist eine zeitaufwendige und etwas heikle Arbeit.
Aus diesen Gründen wurde der mechanische Regler recht früh durch eine elektronische Version ersetzt.
Der elektronische Regler
Beim elektronischen Regler werden die mechanischen Schalter durch Transistoten oder Thyristoren ersetzt. Diese elektronischen Schalter können sehr viel schneller reagieren und arbeiten verschleißfrei. Zur Ansteuerung dieser Schalter wird die Ausgangsspannung des Gleichrichters über einen Vorwiderstand an eine Zener-Diode geleitet. Diese Diode schaltet bei einer definierten Spannung durch und erzeugt so die Ansteuerung für die nachgeschaltete Leistungselektronik. Über den eigentlichen Schalter wird nun ein Teil der Generatorspannung an Fahrzeugmasse abgeleitet. Sinkt die Spannung wieder unter die Schaltschwelle der Z-Diode, öffnet der Schalter und die Spannung steigt wieder. Dieser Vorgang wiederholt sich in sehr schnellem Wechsel, so daß die Ausgangsspannung innerhalb enger Grenzen stabil bleibt. Dabei spielt die vom Generator gelieferte Spannung und der vom Bordnetz benötigte Strom keine bzw. eine nur sehr geringe Rolle.
Da durch den Verluststom innerhalb des Reglers Wärme entsteht, ist auf ausreichende Kühlung zu achten. Aus diesem Grund sind die Gehäuse meist aus Metall und mit ühlrippen versehen. In vielen Fällen findet man Gleichrichter und Regler in einem Gehäuse. Das spart Platz und externen Verkabelungsaufwand.
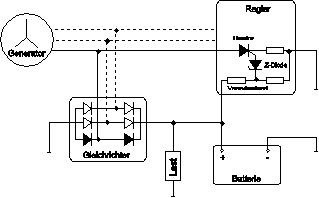
Abb.3 Beispiel eines Reglers mit Thyristor (nur eine Phase dargestellt)
Die Vorteile der elektronischen Regelung sind:
1. Kein Verschleiß und somit lange Lebensdauer
2. Stabile Ausgangsspannung innerhalb der Sollvorgaben
3. Optimale Batterieladung
4. Lange Lebesdauer der Verbraucher
5. Kleine Bauform
6. Keine Einstellarbeiten erforderlich
Die hier beschrieben Arten von Reglern sind nur die Grundprinzipien. Im Laufe der Zeit wurden die Schaltungen immer weiter verfeinert und verbessert. Das Grundprinzip ist jedoch immer gleich.